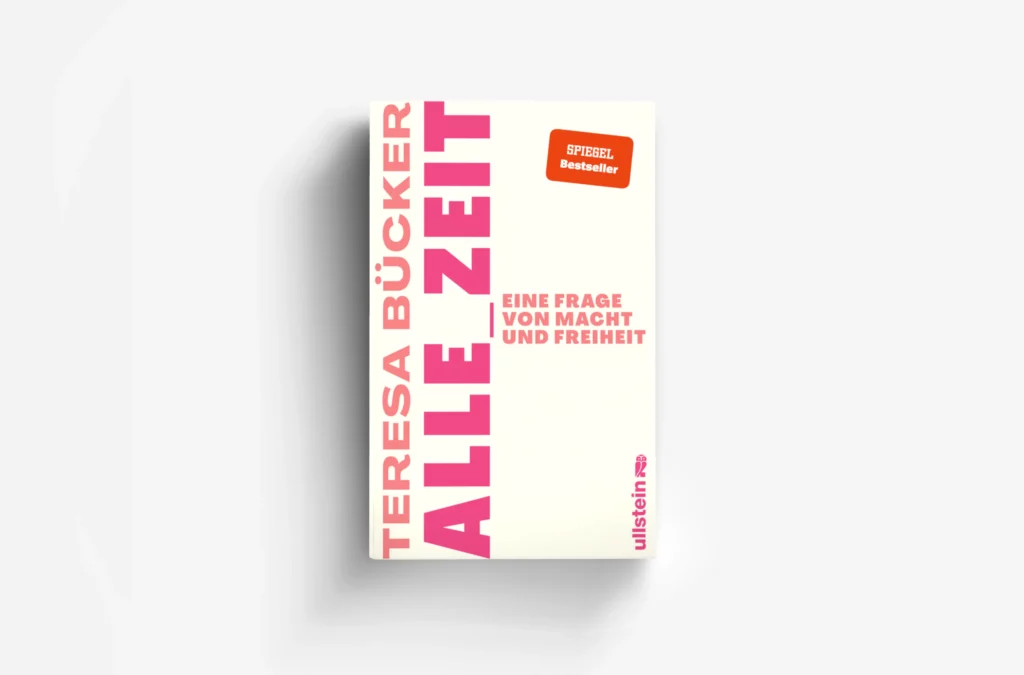Die Kriege in Nahost und zwischen Russland und der Ukraine bewegen derzeit die Linke weltweit, andere finden gleichzeitig unter der Wahrnehmungsschwelle statt. Während zumindest in Gaza nach US-Vermittlung ein fragiler Waffenstillstand herrscht, wird der Ukraine-Krieg mit unvermittelter Härte fortgesetzt. Im Folgenden ein Überblick über diverse globale Konflikte, die anscheinend niemanden interessieren.
Von Georg Elser
Viele kriegerische Auseinandersetzungen, über die nur wenig berichtet wird, finden derzeit in Afrika statt. So schlagen sich etwa derzeit Truppen mit maßgeblicher Unterstützung aus Ruanda raubend, mordend und vergewaltigend durch den Ostkongo, während Paul Kagame, der ruandische Präsident, kaum Kritik befürchten muss. Kagame ist vielmehr ein Freund der ganzen Welt und im Westen wie Osten gerne gesehener Gast. Der ruandische Raubzug hat einen beträchtlichen Anteil an den Millionen Opfern des Kongo-Konflikts der letzten Jahrzehnte zu verantworten.
Der Bürger:innenkrieg in Äthiopien zählt zu den blutigsten in der Gegenwart. In den vergangenen Jahren sind in und um die Region Tigray hunderttausende Menschen aufgrund der Kämpfe ums Leben gekommen. Der aktuelle Konflikt hat sich in die Region Amhara verlagert, wo die täglichen Opferzahlen mit dem Krieg in der Ukraine mithalten können. Es handelt sich um einen ethnisch motivierten Konflikt bei dem Hunger von der äthiopischen Regierung dezidiert als Waffe eingesetzt wird.
Im Sudan findet gerade ein Massenmord mit besonderem historischem Hintergrund statt. Die arabischstämmige Bevölkerung im Sudan war jahrhundertelang massiv am internationalen Sklavenhandel sowohl in die arabische Welt, wie auch in Richtung europäischer Kolonien beteiligt. Ihr Opfer war die schwarze Bevölkerung im Süden. Aktuell sind es erneut arabische Milizen, welche die schwarze Bevölkerung im Süden und Osten zu Tausenden vertreiben und ermorden. Es ist nach den Kriegen im Südsudan und in Darfur der dritte große Konflikt der letzten Jahrzehnte im Sudan.
Im Jemen tobt seit Jahren ein brutaler Krieg zwischen der schiitischen Bevölkerungsgruppe und den sunnitischen Nachbarstaaten des Jemen. Geführt wird dieser Krieg hauptsächlich von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Huthi sind keine Heiligen, aber Hunger und Cholera sorgen wegen der Blockade des Jemen für zehntausende tote Zivilist:innen aufseiten der jemenitischen Bevölkerung. Besonders betroffen sind wie so oft Kinder.
Von Afrika nach Asien
Indonesien setzt seit Jahrzehnten auf die Vertreibung und Marginalisierung der einheimischen Papua Völker in West-Papua. Kolonist:innen aus den Zentralinseln werden nach Westpapua umgesiedelt und der Widerstand der dort wohnenden Bevölkerung militärisch mithilfe von Konzernarmeen, die riesige Goldminen im Dschungel erhalten, bekämpft. Durch das Programm »Transmigrasi« werden seit 1969 Menschen aus der muslimischen Mehrheitsbevölkerung Javas auf andere Inseln, insbesondere jene mit anderen religiösen Mehrheiten umgesiedelt und so versucht die gesamte Inselgruppe zu islamisieren. Erwähnenswert ist auch ein Genozid mit Millionen Opfern in den 1960er Jahren, welcher bis heute in keinster Weise aufgearbeitet ist.
Der Bürger:innenkrieg in Myanmar gehört zu den blutigsten der Welt. Die Zentralregierung bekämpft rücksichtslos die eigene Bevölkerung und dabei werden manchmal ganze Dörfer abgeschlachtet. Jeglicher Widerstand wird gnadenlos verfolgt. Myanmar ist ein Vielvölkerstaat, in dem gewisse Bevölkerungsgruppen über viel Autonomie verfügen und andere, besonders die muslimische Minderheit, stark unterdrückt werden.
Selektive Wahrnehmung
Neben diesen Konflikten finden sich weltweit zahlreiche weitere die ohne nennenswertes internationales Interesse stattfinden. Wir müssen uns die Frage stellen, warum diese Kriege nicht nur in den bürgerlichen Medien, sondern auch in der linken Mediensphäre kaum thematisiert werden, handelt es sich doch um einige der brutalsten Konflikte weltweit.
Eine besondere Kritik verdient die Linke angesichts des offensichtlichen Widerspruchs, der sich aus der – richtigerweise oft betonten – Gleichheit der Menschen ergibt: Im Süden werden weder Täter:innen noch Opfer als selbständige Akteure wahrgenommen. Zurückzuführen ist dies wohl auf eine sträflich einfache Sicht auf die Imperialismustheorien Lenins und eine ebenso vereinfachte Übernahme gewisser antikolonialer Diskurse aus den USA. Das mündet in paternalistischem Denken gegenüber genau jenen Menschen, die man vorgibt schützen zu wollen, und einer Vorstellung wonach das gesamte Elend der Welt auf den westlichen Imperialismus zurückzuführen sei. Konsequenterweise sind daher nur jene Konflikte beachtenswert, an denen wir als »der Westen« aktiv beteiligt sind. Es macht nur die weißen Menschen im Nordens zu Akteur:innen und den Süden als Ganzes entweder zum wehrlosen Opfer, bzw. zu Subjekten westlicher Allmachtphantasien. Es gibt noch eine weitere Konsequenz dieses Denkens: die Solidarisierung mit den übelsten reaktionären Kräften unter dem Deckmantel des »Antikolonialen Freiheitskampfes«.
Sicher, der Westen hat ungleich mehr Macht und Mittel um global Druck auszuüben als die meisten anderen Weltgegenden. Aber alle Konflikte auf dieses schwarz/weiß Schema zurückzuführen ist sträflich vereinfacht. Es enthebt lokale politische Eliten nämlich der Verantwortung für ihre Verbrechen. Paul Kagame ist seit 20 Jahren Präsident Ruandas, wann wird er endlich als selbständig handelndes Subjekt wahrgenommen und wann darf/muss er die Verantwortung für seine Taten übernehmen? Global wäre neben dem Blick auf die Täter:innen auch ein Blick auf die Opfer wichtig. Diese könnten etwas Aufmerksamkeit und internationale Solidarität in ihrem Kampf gegen Tyrannei und Gewalt nämlich sehr gut gebrauchen.