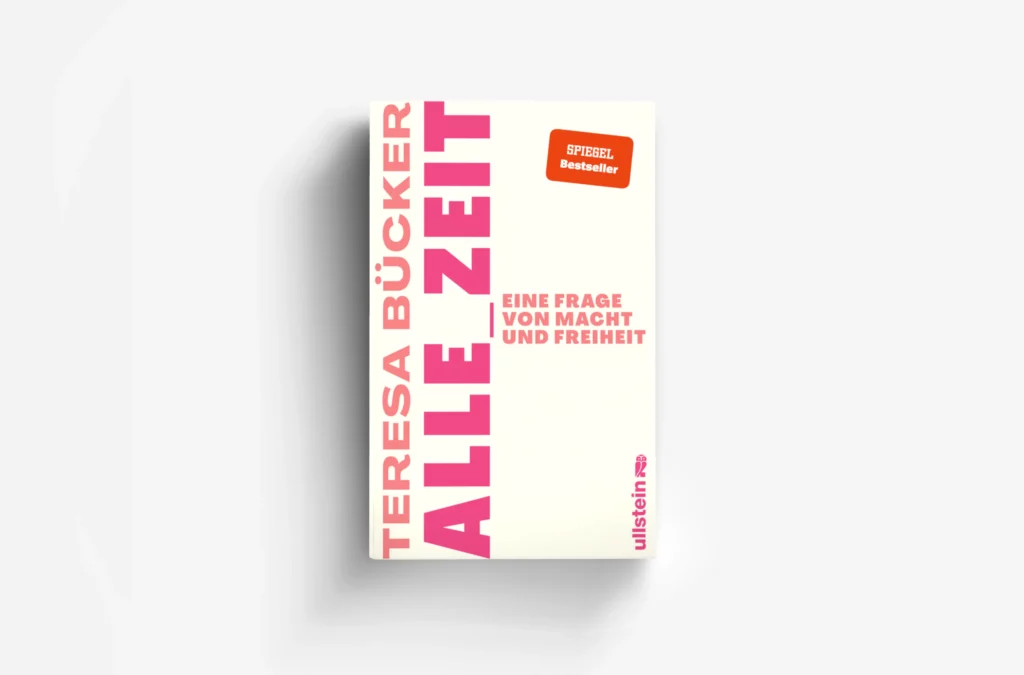
Bildquelle: Ullstein Verlag
Keine Zeit
Von Fiona Sinz
In »Alle_Zeit« widmet sich Teresa Bücker ausführlich dem Thema Zeitpolitik. Im Zentrum steht Zeit als zentrale Ressource unserer Gesellschaft, die jedoch oftmals nicht als solche begriffen wird. Wer wann warum Zeit für was verwenden kann oder muss, ist eine grundsätzlich politische Frage und spiegelt nicht nur gesellschaftliche Ungleichheiten wider, sondern erzeugt und reproduziert diese. Die Freiheit, über die eigene Zeit verfügen zu können, und weiter die Zeitnutzung von anderen zu beeinflussen, ist ein integraler Bestandteil von Macht und Machterhalt. In einer kapitalistischen Gesellschaft, in der die Erwerbsarbeit und die Zeit, die für sie aufgewendet wird, auf ein Podest gestellt wird, verliert die Freizeit immer mehr an Bedeutung. Doch was ist das eigentlich, diese »Freizeit«?
Menschen tendieren dazu, sich über die Nutzung ihrer Zeit zu definieren. Es ist wichtig, die Zeit mit »sinnvollen« und »interessanten« Tätigkeiten zu füllen, wir suchen nach »Erfüllung« und wollen uns als »wertvoller« Teil der Gesellschaft sehen. Dabei geht es vor allem um die Zeit, die wir mit bezahlter Arbeit verbringen. Als eindrückliches Beispiel bringt Bücker die klassische Vorstellungsrunde: Hallo, mein Name ist ____ und ich arbeite als ____. Die Erwerbsarbeit ist im Gegensatz zur Zeit, die wir unbezahlt verbringen, stark identitätsstiftend. So nennt man äußerst selten zuerst ein Hobby oder eine Charaktereigenschaft, um sich anderen vorzustellen. Damit öffnet sich eine Kategorie, anhand derer wir uns und andere bewerten und zuordnen. Menschen, die aus verschiedensten Gründen keiner Erwerbsarbeit (mehr) nachgehen, sehen sich mit einem gewissen Identitätsverlust konfrontiert, da ihre Zeitnutzung als nicht wertvoll empfunden wird. Gleiches gilt für Menschen mit Berufen, die als nicht wertvoll oder interessant genug gesehen werden.
Laut der Studien, die Bücker nennt, wird Zeitknappheit von allen Gesellschaftsschichten unabhängig von Klasse und sozialem Standing wahrgenommen. Dass Zeit eine endliche Ressource ist und damit »knapp«, wird Kindern explizit beigebracht, und ihre Wahrnehmung als solche gilt als wichtiger Schritt im Erwachsenwerden. Im Gegensatz zu vielen anderen Ressourcen kann sie jedoch nicht aufgespart werden und zum Beispiel im Alter genutzt werden, auch ist Zeit, in der wir gesund und agil sind, vielseitiger einsetzbar und damit etwas »freier« als die Zeit im Alter. Einfach auf die Pension warten funktioniert also nicht. Wie wir diese Zeitknappheit jedoch wahrnehmen und in welchen Lebensbereichen sie uns einschränkt, unterscheidet sich fundamental nach finanziellen und sozialen Merkmalen. Besonders interessant und beschäftigt zu wirken, ist zum Beispiel eher ein Problem der Oberschicht. Auch extrem lange Arbeitszeiten plagen eher gut verdienende Männer. Dass man neben der Arbeit am Arbeitsplatz und der Arbeit zu Hause, wie etwa Kinderbetreuung, keine Zeit mehr für ausreichend Bewegung hat, ist ein grundsätzlich weibliches Problem. Wer das Geld hat, die Arbeit zu Hause großflächig auslagern zu können, also Personen für diese Arbeit zu beschäftigen, spürt die Auswirkungen davon im Alter natürlich weniger.
Bücker behandelt den Einfluss von Zeitpolitik auf patriarchale Strukturen besonders ausführlich und hält den Lesenden immer wieder mit deprimierenden Zahlen vor Augen, wie ungleich verteilte Care-Arbeit zum Beispiel Müttern die Zeit raubt, wie wir als Mädchen erzogenen Kindern beibringen, wie sie ihre Zeit zu nutzen haben. Besonders einprägend war hier das Thema Homeoffice: »Bei Müttern führt das Homeoffice […] sogar dazu, dass sie nicht nur länger für ihren Job arbeiten, sondern sich zusätzlich etwa drei Stunden mehr um ihre Kinder kümmern als Mütter mit außerhäusigem Arbeitsplatz. Väter arbeiten zu Hause bis zu sechs Stunden mehr pro Woche als im Büro, kümmern sich aber weniger um ihre Kinder als Väter mit festem Arbeitsplatz im Unternehmen.« Bücker sieht Care-Arbeit ganz klar als Arbeit und sieht diese daher als im Diskurs und in der Gesellschaft ungerecht behandelt gegenüber der Erwerbsarbeit. Daher hagelt es seitenweise Kritik für das, was die Autorin weißen Karriere-Feminismus – jüngere Generationen nennen ihn oft »girlboss feminism« – nennt, der Klasse und intersektionale Unterdrückung aus seinem Verständnis der feministischen Befreiung ausschließt.
Bücker beschreibt in »Alle_Zeit« ausführlich belegt den Status quo der Zeitungleichheit in der kapitalistischen Gesellschaft. Vor allem aber versucht sie sich an dem Ansatz einer Zeit-Utopie. »Muss das so sein?« und »Wie können wir das besser machen?« scheinen die grundoptimistischen führenden Fragen hinter dem Text zu sein. Das Buch ist also in keinem Fall zynisch, auch wenn die Faktenlage zur Thematik das eindeutig hergeben würde. Langwierig wird jeder Aspekt der Zeit im menschlichen Alltag aufgedröselt, erklärt und problematisiert. Als Einstiegswerk ist es damit zwar inhaltlich zugänglich, durch seine Länge mit 330 Seiten braucht man aber Durchhaltevermögen. Neben der Einbettung von zahlreichen Studien und Forschung setzt sich das Buch tiefgehend mit der Politik rund um die Zeit auseinander. Die Errungenschaften, aber vor allem die Versäumnisse der Gewerkschaften rund um Zeitpolitik kritisiert Bücker, aber nicht ohne Verbesserungsanleitung für die Zukunft. Gleichzeitig bemüht sich die Autorin um den Diskurs rund um Zeitpolitik. Bücker ist der einleuchtenden Auffassung, dass, wie wir über Zeit(politik) reden, ändern kann, wie wir sie nutzen – oder zumindest ändert, was wir fordern und erkämpfen können.